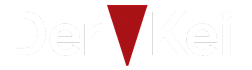Sicherheitswahn – Wie Angst zur Gelddruckmaschine wird
Wir leben in einer Zeit, in der die Worte Sicherheit und Bedrohung wie Werkzeuge geschwungen werden, um die politische Landschaft zu formen und die öffentliche Meinung in bestimmte Bahnen zu lenken. Es ist an der Zeit, brutal ehrlich zu sagen, was viele denken, aber nur wenige laut aussprechen. Nicht weil die Bedrohung aus der Luft gegriffen wäre, sondern weil die Politik die Angst vor dieser Bedrohung benutzt. In Deutschland wurde nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ein Sondervermögen von hundert Milliarden Euro beschlossen, ein historischer Geldstrom in Richtung Militär und Rüstung, den niemand mehr als bloße Ausnahme betrachten kann. Dieses Geld hat die Industrie, die jahrzehntelang eher Randexistenz war, auf einen Schlag zu einem der attraktivsten Sektoren für Investitionen gemacht.
Gleichzeitig explodieren die Aufträge und die Gewinne der Rüstungsindustrie. Konzerne wie Rheinmetall melden Rekordzahlen, ihre Bestellbücher für Waffen und Munition quellen. Werkhallen werden ausgebaut, neue Munitionsfabriken geplant, Standorte erweitert. Das ist keine abstrakte These, das sind Bilanzen, Anlagenpläne und Bauaufträge. Wer jetzt noch behauptet, es ginge allein um Abschreckung, verschließt die Augen vor der Tatsache, dass hier ein ökonomisches Kraftwerk angefacht wurde, dessen Gewinner längst feststehen.
Man muss das klar auseinanderhalten, es gibt reale geopolitische Risiken. Es gibt einen brutalen Krieg in Europa, es gibt hybride Angriffe, Drohnen und gezielte Eskalationen, aber die Frage, die man stellen muss, ist nicht nur die nach Gefahr und Gegenwehr. Die Frage ist, wer politisch von der Erzählung der Gefahr profitiert. Deutschland hat seine Verteidigungsausgaben in kurzer Zeit so stark erhöht, dass Analysten und Institute es als eines der Länder mit dem massivsten Aufrüstungsprogramm Europas bezeichnen. Diese Gelder fließen nicht neutral durch ein Sieb, sie fließen in die Fabriken, die Bestellungen abwickeln, in Werkverträge, Zulieferketten, Forschung und Entwicklung. Für die Politik ist das verlockend, mit dem Mantel der Sicherheit lassen sich Entscheidungen durchdrücken, die sonst kaum Mehrheiten finden würden.
Und dann die Rhetorik, Politiker und Kommentatoren malen häufig das düsterste Szenario an die Wand, die schlimmstmögliche Eskalation. Dabei wird die Ungewissheit in Gewissheit verwandelt und die Hypothese zur Realität erklärt, Expertenmeinungen sind dabei ambivalent. Viele Fachleute betonen, dass ein offener Angriff Russlands auf die NATO aus Sicht Moskaus selbstmörderisch wäre und derzeit keine harten Belege dafür vorliegen. Gleichzeitig warnen andere, dass Russland sich in einigen Szenarien innerhalb weniger Jahre zu einer ernstzunehmenden Bedrohung entwickeln könnte. Diese Spannbreite wird in der politischen Kommunikation jedoch selten sauber dargestellt. Stattdessen wird der worst case als unmittelbare Gewissheit verkauft, weil das Angst schafft und Angst Handlungsfähigkeit legitimiert.
Das Ergebnis ist ein doppeltes Vergehen. Erstens wird die Bevölkerung in ständige Alarmbereitschaft versetzt, Bürger geben bereitwillig Grundfreiheiten, Zustimmung für Ausgaben und Vertrauen in eine Politik, die ihnen klare Bedrohungsbilder präsentiert. Zweitens aber lenkt diese Politik elementare Ressourcen aus Bereichen ab, die das tägliche Leben der Menschen tatsächlich sichern und verbessern würden. Schulen, Krankenhäuser, soziale Infrastruktur und Energieunabhängigkeit stehen im Wettbewerb um knappe Mittel mit einem gigantischen Aufrüstungsprogramm, das zudem privatwirtschaftliche Gewinner auf Kosten des Steuerzahlers schafft. Das ist nicht nur schlechte Prioritätensetzung, es ist ein systemischer Betrug an denen, die das Geld aufbringen müssen.
Ich nenne das beim Namen, es ist Ablenkung und Umverteilung zugleich, Angst ist das Geschäftsmodell. Während der Normalbürger über steigende Lebenshaltungskosten stöhnt und seine Energierechnung fürchtet, füllt sich die Bilanz einiger weniger Aktionäre mit Gewinnen, die direkt aus dem Narrativ von Gefahr und Verteidigung gespeist werden. Das ist moralisch verwerflich, es ist politisch manipulativ und es ist wirtschaftlich kurzsichtig, weil es eine Abhängigkeit schafft, die den Frieden selbst gefährden kann. Industrien, die ihre Existenz an Rüstungsaufträge koppeln, haben ein intrinsisches Interesse an einer permanenten Bedrohungslogik. Das ist die Pervertierung demokratischer Entscheidungsfindung.
Natürlich ist es bequem, all das zu einem einfachen Komplott zu machen, als sei alles gesteuert und geplant. Vieles ist chaotisch, vieles ist Ergebnis von Angst, Lobbyarbeit und Opportunismus. Aber gerade weil es nicht immer eine zentrale Verschwörung gibt, ist die Verantwortlichkeit so schwer zu greifen und so wirksam. Politik, Medien und Wirtschaft schaffen gemeinsam ein Klima, in dem die Instrumentalisierung der Angst normal geworden ist. Wer das kritisiert, wird schnell als unsolidarisch oder naiv gebrandmarkt. Das ist taktisch klug und rhetorisch kalt, es disqualifiziert die Debatte, bevor sie überhaupt geführt wird.
Wenn die Schlafschafe aufwachen sollen, dann nicht durch Verschwörungsszenarien sondern durch nüchterne Fakten und durch den klaren Blick auf Interessen. Wer profitiert von Milliardenaufträgen, wer sitzt an den Werkbankreihen der neuen Rüstungsfabriken, welche Unternehmen schreiben heute Gewinne, die morgen wieder Verlust tragen würden, wenn Frieden und Stabilität zur Norm würden. Es geht nicht darum, die Verteidigung zur Debatte zu stellen, sondern darum, die Verteidigung nicht als Vorwand zu benutzen. Sicherheit darf kein Freifahrtschein für Umverteilung sein, die die Gesellschaft in zwei Klassen teilt, die Steuerzahler und die Profiteure.
Zum Schluss ein Aufruf, der unangenehm ist. Jede demokratische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass ihre Bürger Fragen stellen, dass sie die Narrative, mit denen Politik gemacht wird, kritisch prüfen. Wer behauptet, es ginge ausschließlich um Abschreckung und um die Sicherheit der Bevölkerung, der schuldet den Menschen Rechenschaft über die Verteilung der Mittel und die Interessengruppen hinter den Entscheidungen. Wer Angst sät, muss auch erklären, wem die Saat nützt und wer davon profitiert, dass wir in einem dauernden Ausnahmezustand leben, der hat kein Interesse an Ruhe, Stabilität und Normalität. Das ist die bittere Wahrheit, wer das erkennt handelt, wer das nicht erkennt bezahlt.