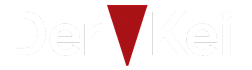Zwischen Feierabendbier und Vollabsturz – Was entscheidet, wer im Alkohol gefangen wird?
Alkohol ist eine der wenigen Drogen, die gesellschaftlich akzeptiert, steuerlich verwertet und gleichzeitig in Millionen Biografien zerstörerisch präsent sind. Die irritierende Erfahrung dabei ist, dass es offenbar zwei Welten gibt. Menschen, die ein Bier oder zwei trinken, an Geburtstagen anstoßen, im Urlaub mal über die Stränge schlagen und dann einfach weitermachen, als sei nichts gewesen, und Menschen, bei denen dieselbe Substanz eine Spirale aus Kontrollverlust, Lügen, Verwahrlosung, Depression und körperlichem Zusammenbruch auslöst. Die eine Hälfte spricht von Genuss, die andere beschreibt die Hölle auf Erden.
Wenn man verstehen will, warum das so ist, muss man mehrere Ebenen auseinanderziehen. Biologie, Psychologie, soziale Prägung, Lernerfahrungen, all das spielt hinein. Es gibt nicht den einen magischen Faktor, der entscheidet, ob jemand „gut mit Alkohol umgehen kann“ oder nicht, aber es gibt eine Reihe harter Fakten, die erklären, warum manche Menschen von vornherein auf einem sehr viel gefährlicheren Weg unterwegs sind, sobald sie anfangen zu trinken.
Auf der biologischen Ebene beginnt alles im Gehirn. Alkohol wirkt im zentralen Nervensystem vor allem über das GABA-System, also ein hemmendes Botenstoffsystem, das Angst und innere Anspannung dämpft, und über das Glutamat-System, das für Erregung und Lernprozesse zuständig ist. Gleichzeitig wird im Belohnungssystem Dopamin ausgeschüttet. Das subjektive Ergebnis dieser Kombination ist für viele Menschen am Anfang ausgesprochen angenehm. Sie werden lockerer, fühlen sich weniger gehemmt, Probleme rücken scheinbar in den Hintergrund. Entscheidend ist, dass diese “Entlastung” im Gehirn als starke Belohnung abgespeichert werden kann, insbesondere wenn innere Anspannung, Scham oder Stress ohnehin sehr hoch sind.
Hinzu kommt, dass es deutliche genetische Unterschiede darin gibt, wie stark Menschen auf Alkohol reagieren und wie hoch ihr Risiko für eine Abhängigkeit ist. Zwillings- und Familienstudien zeigen seit Jahren, dass bei Alkoholabhängigkeit ungefähr die Hälfte des Risikos auf genetischen Faktoren beruht. Wer Eltern oder Großeltern mit Alkoholproblemen hat, trägt ein messbar höheres Risiko, selbst eine Störung zu entwickeln. In neueren genetischen Analysen wurden zahlreiche Varianten identifiziert, die mit veränderter Alkoholverstoffwechselung, erhöhtem Konsum oder höherer Anfälligkeit für Suchterkrankungen zusammenhängen. Damit ist klar, es gibt Menschen, deren Nervensystem und Stoffwechsel von vornherein so gestrickt sind, dass Alkohol bei ihnen „besser“ andockt, stärker belohnt, länger nachwirkt oder langsamer abgebaut wird. Für sie ist der Weg in die Abhängigkeit steiler und schneller als für andere.
Das erklärt allerdings noch nicht, warum ein Teil trotzdem vergleichsweise problemlos trinkt. Hier kommt die psychische und soziale Ebene ins Spiel. Menschen unterscheiden sich massiv darin, wofür sie Alkohol benutzen. Es gibt die klassische „Genuss“-Verwendung, etwa ein Glas Wein zu einem guten Essen, ohne dass damit ein Problem reguliert werden soll. Und es gibt den „Selbstmedikations“-Konsum, Alkohol um soziale Angst zu betäuben, um nach der Arbeit „herunterzukommen“, um Einsamkeit, Schuldgefühle, innere Leere oder Traumafolgen zu dämpfen. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit Angststörungen, Depressionen, traumatischen Kindheitserfahrungen oder Persönlichkeitsstörungen deutlich häufiger problematisch trinken. Alkohol wird dann nicht als gelegentliche Verstärkung eines angenehmen Moments genutzt, sondern als Werkzeug, um überhaupt noch auszuhalten, wie sich das eigene Leben anfühlt.
Wer zusätzlich gelernt hat, Gefühle eher zu unterdrücken als zu regulieren, wer nie Strategien entwickelt hat, mit Stress, Wut oder Kränkung anders umzugehen, für den ist Alkohol eine Verlockung. Er wirkt schnell, er ist legal, er ist billig, und er wird gesellschaftlich an nahezu jeder Ecke angeboten. Das Belohnungssystem merkt sich sehr präzise, dass ein bestimmtes Grammmaß Alkohol verlässlich dafür sorgt, dass innere Unruhe für ein paar Stunden verschwindet. Wenn sich dieser Lernprozess einprägt, reicht irgendwann schon der Gedanke an Stress, Streit oder Einsamkeit, damit das Verlangen nach der Flasche anspringt. In der Suchtmedizin spricht man von konditionierten Reizen. Auslöser sind nicht nur der Stoff selbst, sondern Situationen, Orte, Uhrzeiten, Gerüche, Personen, Emotionen.
Für die Menschen, die „gut mit Alkohol umgehen können“, verlaufen diese Lernprozesse anders. Entweder haben sie weniger innere Konflikte, die sie damit regulieren müssten, oder sie verfügen über alternative Bewältigungsstrategien, die sie als wirksam erlebt haben: Sport, Gespräche, Hobbys, klare Routinen, soziale Regeln im Freundeskreis oder in der Familie. Außerdem erleben sie nicht unbedingt dieselbe Wucht an Belohnung. Wer nach zwei Bier eher müde und schwer wird, statt euphorisch und erleichtert, hat schlicht weniger Grund, aus Alkohol ein Werkzeug zu machen. Bei ihnen bleibt die Substanz näher an dem, was die Werbung suggeriert, Beiwerk zu geselligen Momenten, nicht heimlicher Hauptdarsteller des inneren Überlebens.
Die Hölle beginnt dort, wo Alkohol zur einzigen funktionierenden Antwort auf innere oder äußere Konflikte geworden ist. Dann verschiebt sich über Monate und Jahre die gesamte innere Statik, das Gehirn passt sich an den Dauerbeschuss mit Alkohol an. GABA- und Glutamatsystem werden neu kalibriert, die eigene Stressachse wird empfindlicher, Belohnungssignale stumpfen ab. Im Klartext, ohne Alkohol fühlt sich dann alles grauer, leerer, nervöser an. Der körperliche Entzug ist die sichtbarste Spitze, mit Zittern, Schweiß, Unruhe und in schweren Fällen Krampfanfällen, aber die tiefere Hölle ist die psychische, alles dreht sich darum, die nächste Gelegenheit zu finden, zu trinken. Beziehungen werden zweitrangig, Verpflichtungen werden gebrochen, eigene Werte werden permanent überschritten. Es entsteht ein Doppelleben aus Fassade und Versteckspiel.
An diesem Punkt ist es irreführend zu sagen, jemand könne „nicht gut mit Alkohol umgehen“. Es ist nicht mehr eine Frage von Umgang, sondern eine manifest gewordene Suchterkrankung. In Leitlinien wird Alkoholabhängigkeit als chronische, oft rückfallanfällige Störung beschrieben, die durch Kontrollverlust, starkes Verlangen, Toleranzentwicklung, Entzugssymptome und anhaltenden Konsum trotz massiver Schäden gekennzeichnet ist. Die Hölle besteht darin, dass Betroffene gleichzeitig wissen, was der Alkohol ihnen antut, und trotzdem das Gefühl haben, ohne ihn nicht mehr leben zu können. Das ist kein Charakterfehler, kein Mangel an Willenskraft, sondern die Folge konkreter neurobiologischer und psychischer Veränderungen.
Dass die einen dort nie landen, liegt selten daran, dass sie grundsätzlich „bessere Menschen“ sind. Es ist eine Mischung aus genetischer Ausgangslage, frühen Erfahrungen, psychischer Stabilität, sozialem Umfeld und schlichter Biografie. Wer zum Beispiel in einem Umfeld aufwächst, in dem maßvoller Umgang mit Alkohol vorgelebt wird, in dem über Gefühle gesprochen werden darf und in dem Suchtverhalten klar benannt und begrenzt wird, hat größere Chancen, Alkohol nicht als Allzweckwaffe zu missbrauchen. Wer dagegen Gewalt, emotionale Vernachlässigung, Demütigungen oder chronischen Stress erlebt, lernt sehr früh, dass Betäubung eine Option ist. Wenn in so einem Leben die Flasche als zuverlässige Betäubungsmaschine auftaucht, ist der Schritt zur Abhängigkeit deutlich kürzer.
Der nüchterne Kern der Antwort lautet deshalb, ein Teil der Menschen kann „gut mit Alkohol umgehen“, weil bei ihnen mehrere Schutzfaktoren zusammenkommen, eine Biologie, die nicht maximal empfänglich für Abhängigkeit ist. Psychische Muster, in denen Probleme anders verarbeitet werden, soziale Netze, in denen sich Menschen auffangen und oft auch schlichte Zufälle, bei denen riskante Phasen im Leben glimpflich verlaufen. Für andere wird derselbe Stoff zur Hölle, weil sie von mehreren Seiten verwundbar sind, sie trinken nicht, um zu genießen. Sie trinken, um zu funktionieren, zu vergessen, zu überleben, und landen genau deshalb in einem Zustand, in dem nichts mehr funktioniert.
Wer ehrlich hinschauen will, hört deshalb auf, von „starken“ und „schwachen“ Charakteren zu reden. Es geht um Risiko- und Schutzprofile, um biografische Bruchlinien und um eine Droge, die extrem gut darin ist, diese Bruchlinien auszunutzen. Die eine Gruppe schafft es, Alkohol an der Peripherie des Lebens zu halten, die andere wird von ihm ins Zentrum gedrückt, bis alles andere darum kreist. Dass dieser Unterschied existiert, ist keine moralische Ordnung, sondern eine Mischung aus Biologie und Biografie und für die, die auf der falschen Seite landen, fühlt es sich genauso an, wie du es genannt hast. Wie die Hölle auf Erden.
Lesen Sie auch:
https://www.webwerk-bg.com/raucher-als-verschleissware/