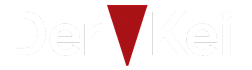Wie Deutschland die europäische Wiederaufrüstung anführen will
Deutschland positioniert sich neu auf der sicherheitspolitischen Landkarte Europas. Ein jüngst bekannt gewordenes internes Strategiepapier aus Berlin zeigt deutlich, dass die Bundesregierung bereit ist, eine treibende Rolle bei der Wiederaufrüstung der Europäischen Union zu übernehmen. Der Kern des Plans besteht darin, sogenannte „kollektive Fähigkeitskoalitionen“ zu schaffen. Damit sind Zusammenschlüsse einzelner EU-Staaten gemeint, die künftig bestimmte Waffensysteme gemeinsam entwickeln und beschaffen sollen. Statt dass jeder Mitgliedsstaat seine Rüstungspolitik isoliert betreibt, soll es eine koordinierte Zusammenarbeit geben, die Kräfte bündelt und Effizienz schafft.
Besonders auffällig ist die Absicht, bürokratische Hürden beim Bau und bei der Beschaffung von Rüstungsgütern deutlich zu senken. Die Produktion soll beschleunigt und weniger stark reguliert werden, damit Europa schneller auf sicherheitspolitische Bedrohungen reagieren kann. Hinter dieser Strategie steckt die Erkenntnis, dass die EU in den vergangenen Jahren oft zu träge agierte und in Krisensituationen wie dem Ukraine-Krieg oder den Spannungen im Nahen Osten auf Lieferungen aus den USA angewiesen war. Deutschland will hier ein Signal setzen, Europa muss in der Lage sein, seine eigene Verteidigungsfähigkeit auf die Beine zu stellen.
Gleichzeitig enthält der Plan eine klare finanzpolitische Botschaft. Anders als manche Befürworter einer umfassenden europäischen Verteidigungsunion, die gemeinsame EU-Schulden zur Finanzierung neuer Projekte ins Spiel bringen, will Berlin diesen Weg nicht gehen. Stattdessen soll die Modernisierung weitgehend aus nationalen Haushalten der beteiligten Länder getragen werden. Damit vermeidet Deutschland einerseits die heikle Debatte um eine neue europäische Schuldenaufnahme, andererseits betont es seine Bereitschaft, auch mit eigenen Mitteln voranzugehen.
Die Initiative birgt weitreichende politische Folgen. Zum einen stärkt sie Deutschlands Rolle als sicherheitspolitischer Akteur, der sich nicht länger nur auf NATO-Strukturen verlässt, sondern die europäische Dimension gezielt nach vorn treibt. Zum anderen sendet sie ein Signal an Partner und Gegner gleichermaßen, Europa soll militärisch handlungsfähiger, unabhängiger und schneller werden. Ob es tatsächlich gelingt, die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsstaaten unter einen Hut zu bringen, bleibt allerdings offen. Traditionell gilt die Verteidigungspolitik als einer der schwierigsten Bereiche europäischer Integration, da nationale Souveränität und Sicherheitsinteressen eng miteinander verwoben sind.
Das Papier zeigt jedoch, dass Deutschland die Zeichen der Zeit erkannt hat. Angesichts wachsender globaler Spannungen, einer unberechenbaren geopolitischen Lage und der zunehmenden Fragilität internationaler Bündnisse soll die EU weniger Zuschauer sein und stärker selbst agieren können. Mit dieser Strategie setzt Berlin auf Führung, Pragmatismus und den Versuch, aus einer Union der einzelnen Armeen eine Union gemeinsamer Stärke zu formen.