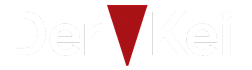Eine Chronik in Graustufen – ohne Parolen, mit Belegen
Es beginnt – wie so oft – nicht mit einem Schuss, sondern mit einem Satz. Am 24. Februar 2022 erklärt Wladimir Putin im Morgengrauen, Russland werde die Ukraine „entmilitarisieren“ und „entnazifizieren“, zum Schutz der Menschen im Donbas – und zur Abwehr einer existenziellen NATO-Bedrohung. Am selben Tag setzt sich eine Kette aus Explosionen in Gang, deren Echo bis heute nicht abreißt. Wer verstehen will, warum, muss zwei Ebenen auseinanderhalten: Was die Akteure sagen, und was die Institutionen feststellen. Putins eigene Begründung steht schwarz auf weiß in seinen Reden und Papieren; der völkerrechtliche Konter ebenso. en.kremlin.ru
Die UN-Generalversammlung verurteilte fünf Tage später – am 2. März 2022 – den Angriff als Aggression und forderte den vollständigen Rückzug russischer Truppen. Das ist kein Kommentar, sondern das protokollierte Votum der Staatengemeinschaft (141 Ja-Stimmen). Der Internationale Gerichtshof ordnete am 16. März im Eilverfahren an, Russland solle die Kampfhandlungen aussetzen – die von Moskau behauptete „Völkermordlage“ im Donbas sei nicht belegt und tauge nicht als Rechtfertigung für Gewalt. Das sind die beiden juristischen Grundpfeiler, an denen jede politische Erzählung sich messen lassen muss. docs.un.orgicj-cij.org
Doch diese Geschichte beginnt früher. 2013/14 bricht in Kiew die Balancepolitik zwischen EU-Annäherung und russischem Einfluss; Präsident Janukowytsch flieht, Russland annektiert die Krim, im Donbas eskaliert ein Krieg geringer Intensität – acht Jahre lang. Das UN-Menschenrechtsbüro bilanziert bis Ende 2021 über 14 000 Tote (Militär und Zivilisten zusammen), die OSZE dokumentiert unablässig Waffenstillstandsverstöße; Minsk bleibt Stückwerk. Das ist der blutige Vorlauf – lange bevor der Großangriff beginnt. The United Nations in Ukraine
Putins Weltbild ist ebenfalls aktenkundig. In seinem Essay „Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern“ (12. Juli 2021) negiert er im Kern eine eigenständige ukrainische Nation und rückt die moderne Ukraine in die Nähe eines „Anti-Russland-Projekts“. Das ist mehr als Strategie: Es ist revisionistische Geschichtspolitik, die erklärt, warum Sicherheitsargumente allein die Entscheidung zum Krieg nicht tragen. Das Dokument liegt bis heute auf der Kreml-Website. en.kremlin.ru
Selenskyj wiederum ist nicht die Figur aus Meme-Duellen, sondern ein politischer Lebenslauf mit klaren Daten: 2019 gewann er die Präsidentschaftswahl deutlich; die OSZE bewertet den Prozess als kompetitiv und gut administriert. Nach der Invasion trifft Kiew harte Kriegsrechts-Entscheidungen: ein landesweiter TV-„Telethon“ bündelt Nachrichtensendungen zu einer einheitlichen Informationspolitik (Dekret 152/2022), 11 Parteien mit mutmaßlichen Verbindungen zu Russland werden zunächst suspendiert und später – per Gesetz bzw. Gericht – verboten. Das ist politisch umstritten und demokratisch heikel, aber öffentlich dokumentiert. osce.orgimi.org.uaRadioFreeEurope/RadioLiberty
Zwischen den Fronten läuft die Debatte über die Rolle des Westens. Die NATO schrieb in Bukarest 2008, die Ukraine und Georgia „werden Mitglieder werden“ – ohne Zeitplan. Realistische Stimmen wie John J. Mearsheimer werten genau diese Signale als zentralen Eskalationsfaktor; ein gewichtiger, aber umstrittener Strang der Forschung. Gegenpositionen (u. a. Brookings/Carnegie) sehen den Kern im imperialen Anspruch des Kreml und der Verweigerung, die ukrainische Staatlichkeit zu akzeptieren – belegt durch Putins eigene Texte und die Politik seit 2014. Beide Lesarten erklären etwas; keine ändert die völkerrechtliche Ausgangslage. nato.intJohn MearsheimerBrookingscarnegieendowment.org
Im Informationsraum ziehen alle Seiten die Zügel an: Russland schafft im März 2022 ein Zensur-Regime mit Haft bis zu 15 Jahren für vermeintliche „Falschnachrichten“ über die Armee; die EU setzt die Verbreitung der Staatsmedien RT und Sputnik aus – begründet als Sanktionsmaßnahme gegen Kriegspropaganda; die Ukraine bündelt TV-News im Kriegsrecht. Drei Ziele, drei Logiken – mit dem gemeinsamen Effekt: schmalere öffentliche Korridore. hrw.orgconsilium.europa.euimi.org.ua
Die Gewaltbilanz seit 2022 ist massiv – und asymmetrisch. Der Internationale Strafgerichtshof erließ im März 2023 Haftbefehle gegen Putin und seine Kinderbeauftragte wegen rechtswidriger Deportation ukrainischer Kinder; 2024 folgten weitere Haftbefehle gegen Shoigu und Gerasimov wegen Angriffen auf zivile Energieinfrastruktur. Parallel dokumentieren UN-, OSZE- und NGO-Berichte in besetzten Gebieten rechtswidrige Inhaftierungen, Folter, erzwungene „Russifizierung“ – systematisch und breit. Das sind keine Meinungen, sondern juristische und forensische Feststellungen. icc-cpi.intLe Monde.frosce.org
Zu Waffenwirkungen gilt: Streumunition wurde vielfach von Russland eingesetzt; es gibt zudem nachweisliche ukrainische Einsätze (u. a. Raum Isjum 2022). Beides ist humanitär verheerend, rechtlich besonders heikel, weil die Ukraine Vertragsstaat des Ottawa-Abkommens ist (Minen) und viele Staaten Streumunition ächten. Wer ernsthaft Bilanz zieht, nennt beides – und hält die Unterscheidung fest: Umfang und Systematik der dokumentierten Verstöße liegen auf russischer Seite deutlich höher. hrw.org+1
Warum der Stimmungsumschwung gegen Russland? Globale Umfragen zeigen seit 2022 klar negativere Werte; 2024 liegt der Median negativer Ansichten in 35 Ländern bei 65 %. Das folgt nicht primär aus „gesteuerten Medien“, sondern aus einem anhaltenden Krieg mit sichtbarer Zerstörung und dokumentierten Verbrechen – Bilder und Berichte, die Einstellungen prägen. Pew Research Center
Und die baltischen Staaten? Offizielle Dienste wie der estnische Auslandsnachrichtendienst halten einen direkten Angriff 2025 für unwahrscheinlich – bei andauernd feindlicher Grundhaltung Moskaus und erhöhter Hybrid-Gefahr (Sabotage, Cyber, Desinformation). Der Unterschied zur Ukraine heißt Artikel 5: ein kollektiver Verteidigungsautomatismus, der kalkulierte Offensiven unattraktiv macht. Risiko: da. Automatismus zum großen Krieg: nein. Välisluureamet
Was bleibt, wenn man Narrative abzieht und nur die Akten sprechen lässt?
Erstens: Der völkerrechtliche Rahmen steht: Aggressionsverbot, territoriale Integrität, UN-Verurteilung des Angriffs; der IGH weist die „Genozid“-Begründung ab. Das heißt nicht, dass Fehleinschätzungen des Westens irrelevant wären – aber sie rechtfertigen keinen Angriffskrieg. docs.un.orgicj-cij.org
Zweitens: Putins Motivbündel ist hybrid: Sicherheitsargumente plus ein revisionistisches Geschichtsbild, das die Eigenstaatlichkeit der Ukraine bestreitet. Das erklärt die Härte, nicht die Rechtmäßigkeit. en.kremlin.ru
Drittens: Verstöße sind tatbezogen zu bewerten. Es gibt belegte ukrainische Fehlverhalten (u. a. Streumunition/Isjum; umstrittene Stationierungen). Die Breite, Tiefe und Systematik der dokumentierten Rechtsbrüche liegt jedoch – nach UN, OSZE, ICC, HRW, Amnesty – überwiegend bei der Okkupationsmacht Russland. Beides ist wahr, das eine relativiert das andere nicht. hrw.org
Viertens: Der Informationskrieg frisst Vertrauen – in Moskau durch Kriminalisierung abweichender Berichterstattung, in Kiew durch kriegsrechtliche Bündelung, in der EU durch Sanktionsverbote gegen Propagakanäle. Demokratie in der Krise bleibt eine Gratwanderung zwischen Resilienz und Offenheit. hrw.orgconsilium.europa.euimi.org.ua
Fünftens: Die Frage „Schuld des Westens?“ ist politikwissenschaftlich strittig, nicht schwarz-weiß. Bukarest 2008 war ein Signal, das in Moskau als Bedrohung gelesen wurde; zugleich zeigen Putins eigene Texte und die Praxis seit 2014, dass es um mehr geht als NATO-Geografie: um Macht über die Ukraine. nato.intBrookings
Wenn du mich fragst, was diese Chronik zeigen soll: Erinnern – nicht an Slogans, sondern an Beschlüsse, Urteile, Zahlen. Erinnerung ist hier kein Trost, sondern ein Prüfstein. Für Regierungen, die Verantwortung tragen. Für Medien, die Korridore eng und breit machen können. Für Leser, die wissen wollen, wie man inmitten von Nebel noch geradeaus geht.
Die einfache Geschichte – Täter hier, Opfer dort, Ende – gibt es nicht. Es gibt Aggression und Verteidigung, es gibt Verbrechen und Beweise, es gibt Fehler auf mehreren Seiten und Entscheidungen, die den Unterschied machen. Die Wahrheit ist nicht bequem. Aber sie ist dokumentiert.
Wichtigste Primär- und Referenzquellen (Auswahl)
UN-Generalversammlung ES-11/1 (02.03.2022) – Aggression gegen die Ukraine. docs.un.org
IGH, Beschluss 16.03.2022 – Eilmaßnahmen, „Genozid“-Begründung nicht belegt. icj-cij.org
Putin: Rede 24.02.2022; Essay 12.07.2021 („historische Einheit“). en.kremlin.ru+1
OHCHR/UN: Opferzahlen Donbas bis 2021; aktuelle Berichte 2024/25. The United Nations in Ukraine+1
ICC: Haftbefehle (Deportation von Kindern; Angriffe auf Energieinfrastruktur). icc-cpi.intLe Monde.fr
HRW / Amnesty: Streumunition (beide Seiten), umstrittene Stationierungen. hrw.orgAmnesty International
Medienordnung: Russland (Zensurgesetze), EU-Sanktionen gegen RT/Sputnik, Ukraine-Telethon. hrw.orgconsilium.europa.euimi.org.ua
NATO Bukarest 2008 (Beitrittsperspektive); Debatte Mearsheimer vs. Gegenpositionen. nato.intJohn MearsheimerBrookings
Pew 2024: Weltweite Sicht auf Russland/Putin. Pew Research Center
Estnischer Nachrichtendienst 2025: Bedrohungsbewertung Baltikum. Välisluureamet