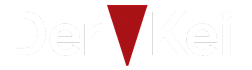Warum immer mehr Deutsche ins günstige Ausland ziehen – und wie sich ihre neue Heimat anfühlt
Raus – und dann? Deutsche Auswanderung seit den 1950ern: Motive, Muster, Missverständnisse
Die deutsche Auswanderung nach 1945 beginnt nicht mit einer romantischen Sehnsucht nach der Ferne, sondern mit harter Realität: Zerstörung, Wohnraummangel, Arbeitslosigkeit. Zwischen 1949 und 1961 verlassen laut amtlichen Statistiken rund 780.000 Deutsche die Bundesrepublik in Richtung Übersee — etwa die Hälfte zieht in die USA, knapp ein Drittel nach Kanada, rund zehn Prozent nach Australien. Es ist der letzte große Nachhall der transatlantischen Migration: Der Westen lockt mit Arbeit, Raum und dem Versprechen eines Neuanfangs. In Deutschland drückt die Nachkriegsnot. So einfach lässt sich die erste Nachkriegsgeneration von „Push“ und „Pull“ erklären. bpb.de
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Westdeutschland und einem enger werdenden Einwanderungsregime in klassischen Zielländern ebbt diese Welle ab. In den 1960er/1970er Jahren sinken die deutschen Auswanderungszahlen deutlich; zugleich verschiebt sich die deutsche Migrationsbilanz insgesamt: Deutschland wird nun vor allem Einwanderungsland (Gastarbeiteranwerbung, später Familiennachzug). Auswanderung bleibt, aber sie verliert den Charakter der Massenbewegung. Die amtlichen Zeitreihen zeigen diese Abkühlung deutlich. Statistisches Bundesamt
Eine Zäsur bringt die Systemwende 1989/90. Die Migrationsbilanz explodiert — vor allem Zuzüge nach Deutschland. In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren kommen Aussiedler/Spätaussiedler in großer Zahl; bis 1992 insgesamt rund 2,8 Mio., danach bis heute weitere ca. 1,7 Mio. Diese Dynamik prägt die Gesamtstatistik, doch sie ist Einwanderung (meist deutscher Staatsangehöriger) und erklärt, warum die öffentlichen Debatten jener Jahre sich kaum um Auswanderung drehen. Svr Migration
Ab den 2000ern ändert sich die Erzählung erneut – leiser, aber nachhaltig. Die Freizügigkeit in der EU, globalisierte Arbeitsmärkte und günstige Flugverbindungen machen den Schritt ins Ausland einfacher. Zugleich lässt sich in den Destatis-Daten ab 2005 eine negative Wanderungsbilanz der Deutschen (also deutscher Staatsangehöriger) erkennen, die sich seither ohne Unterbrechung hält: Jahr für Jahr ziehen mehr Deutsche fort als zurück. 2024 sind es 269.986 Fortzüge deutscher Staatsbürger bei 189.107 Zuzügen – ein Saldo von −80.879. Damit setzt sich der Trend der Vorjahre fort (2023: −73.679). Methodische Hinweise (z. B. Änderungen 2016) ändern an diesem Muster wenig: Die Negativsalden bleiben konsistent. Statistisches Bundesamt
Wer geht? Das verbreitete Bild vom Auswanderer als Ruheständler an der Sonne ist zu kurz. Analysen des IW Köln zeigen: Die stärksten Nettoverluste verzeichnet Deutschland bei 23- bis 31-Jährigen. Es sind häufig mobile, gut ausgebildete Menschen, die Freizügigkeit und globale Nachfrage nach Qualifikation ausspielen. Der „Braindrain“ ist dabei empirisch differenziert zu betrachten: Viele gehen auf Zeit, manche kehren zurück — aber im kritischen Alter der Berufs- und Familiengründung fehlen sie zunächst. Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Warum gehen sie? Die Gründe sind ein Bündel aus Karriere, Einkommen, Lebensstil und Politik. Das zeigen die Paneldaten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB): Berufliche Motive dominieren, dazu kommen Lebensqualität, Familie/Partnerschaft — und ja, auch Frust mit Bürokratie, Steuerlast oder gesellschaftlichem Klima. Bemerkenswert: Auswandern erhöht messbar die Lebenszufriedenheit (im Schnitt um etwa +0,5 Punkte auf einer 0–10-Skala), am stärksten bei Singles; der Effekt hält laut BiB bis zu zwei Jahre an und flacht dann ab. Das ist nüchtern gemessene Psychometrie, keine Postkarte aus dem Paradies. bib.bund.de+1
Wohin gehen sie? Die „großen Vier“ bleiben Schweiz, Österreich, USA, UK. Daneben gewinnen EU-Länder mit niedrigen Lebenshaltungskosten an Sichtbarkeit. Bulgarien ist ein prominentes Beispiel in Debatten — zahlenmäßig aber klein: Zum 1. Januar 2023 sind dort 4.411 Deutsche offiziell registriert. Dass Bulgarien überhaupt im Radar auftaucht, hat rationale Gründe: Preisniveau deutlich unter EU-Schnitt (Eurostat: Bulgarien rund 40 % günstiger als der EU-Durchschnitt) und 10 % Flat Tax auf Einkommen. Für viele mit kalkulierbaren Einnahmen (Rente, remote Arbeit, Unternehmertum) ist das ein klarer Anreiz; die Reibung beginnt dann bei Sprache, Verwaltung und Infrastruktur. Statistisches BundesamtEuropean Commissionminfin.bg
Ist es wirklich eine „Rentnerwelle“? Teilbewegungen — etwa deutschsprachige Communities in Ungarn oder an der bulgarischen Küste — sind sichtbar und medienwirksam. Statistisch aber gilt: Rentner sind eine Gruppe, nicht die Gruppe. Die Altersstruktur der Fortzüge ist breit; Nettoverluste bei jungen Erwachsenen geben arbeitsmarktpolitisch den Ton an. Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Wie schaut die Politik darauf? In Berlin dominiert seit Jahren ein anderes Stichwort: Fachkräftesicherung. Die Bundesregierung reformiert Visa-, Anerkennungs- und Zuwanderungsregeln (Stichwort Fachkräftestrategie), um mehr Menschen nach Deutschland zu holen. Spezifische Maßnahmen gegen die Abwanderung Deutscher sind dagegen selten Thema — eher indirekt über Standortpolitik (Bürokratieabbau, Digitalisierung, Steuer- und Abgabenfragen). Kurz: Man versucht, den Sog nach Deutschland zu erhöhen, statt den Abfluss zu deckeln. bmas.debundeswirtschaftsministerium.de
Wie geht es den Auswanderern „dort draußen“? Abseits der Instagram-Ästhetik mischt sich Euphorie mit Alltag. Die BiB-Daten zeigen den Zufriedenheitssprung nach Umzug; zugleich berichten viele über bürokratische Lernkurven, Sprache, Netzwerke. Länder mit niedrigem Preisniveau liefern zwar finanzielle Entlastung, aber nicht automatisch die gewohnte Service- und Rechtsstaatqualität deutscher Verwaltungen. Wer vorbereitet, vernetzt und realistisch geht, gewinnt — wer nur flieht, tauscht Probleme. bib.bund.de
Und die lange Linie seit den 1950ern? Von der Not-Migration der frühen Nachkriegsjahre über die Auswanderflaute der Wohlstandsdekaden hin zur heutigen hohen, aber individualisierten Mobilität: Deutsche Auswanderung ist kleiner geworden als Mythos, größer als Bauchgefühl. Sie ist jünger, qualifizierter, reversibler. Die nackten Zahlen der letzten Jahre sprechen klar: 2024 verlassen rund 270.000 Deutsche das Land, knapp 190.000 kehren zurück — negativer Saldo. Das ist kein Drama, aber ein Signal: Wer Talente halten will, muss am Standort arbeiten — schneller, einfacher, planbarer. Statistisches Bundesamt
Nachtrag für die Debatte um „Billigländer“: Bulgarien, Ungarn & Co. sind Nischenziele mit handfesten Vorteilen (Kosten, Steuern), aber kleinem Volumen. Eurostat-Preisindizes und Steuerregeln erklären den Reiz; die Destatis-Bestände zeigen gleichzeitig: Die große deutsche Diaspora sitzt anderswo. Wer in der Geschichte deutsche Auswanderung verstehen will, muss deshalb beides sehen — die neuen Kostenoasen und die alten, starken Magneten im deutschen Umland und in der angelsächsischen Welt. European Commissionminfin.bgStatistisches Bundesamt
Quellenhinweise (Auswahl)
Destatis – Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland, 1950–2024 (inkl. Salden für Deutsche). Statistisches Bundesamt
bpb – Auswanderung aus Deutschland; historische Überseeziele 1949–1961. bpb.de
BiB/GERPS – Panelbefunde zu Motiven & Lebenszufriedenheit nach Auswanderung. bib.bund.de+1
IW Köln – Nettoabwanderung besonders stark bei 23- bis 31-Jährigen. Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Destatis Europa – Bestand Deutscher in EU-Ländern (Bulgarien: 4.411 zum 1.1.2023). Statistisches Bundesamt
Eurostat – Preisniveauvergleiche (Bulgariens Preisniveau deutlich unter EU-Durchschnitt). European Commission
Bulgarisches Finanzministerium – 10 % Flat Tax auf persönliches Einkommen. minfin.bg
BAMF/SVR – (Spät-)Aussiedlerzahlen und Zäsur um 1990. Svr Migration