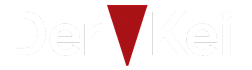Musik ohne Seele – wie Streaming und Kommerz das „Wow“ aus unseren Songs getrieben haben
Es gibt diesen Moment, den fast jeder kennt, der mit den Siebzigern, Achtzigern oder Neunzigern groß geworden ist. Man sitzt im Auto, schaltet durch, landet auf einem „Best of 80s/90s“-Sender, und plötzlich passiert etwas, ein Intro das man nach zwei Sekunden erkennt. Eine Stimme, die nicht einfach singt, sondern trägt, eine Band, die wirklich spielt. Man dreht lauter, summt erst mit, singt dann mit, und für ein paar Minuten ist klar, warum Musik einmal das Wichtigste auf der Welt war.
Dann wechselt man zurück zu „aktuellen Hits“ und findet sich in einer endlosen Playlist wieder, in der alles sauber produziert, perfekt gestreamt, aber irgendwie gesichtslos ist, eine Stimme über einem Beat, der wie fünfzig andere Beats klingt, ein Refrain, der für TikTok-Zeilen geschrieben wurde, ein Song der funktioniert, aber keinen Abdruck hinterlässt. In genau diesem Moment stellt sich die Frage, die viele lieber wegschieben, sind wir alt geworden oder ist die Musikbranche wirklich so verkommen, dass sie uns nur noch mit Wegwerfware berieselt.
Heute läuft Musik nicht mehr über Plattenspieler, Kassette oder CD, die eine Präsenz im Raum hatten, sie läuft über einen Dienst, der unendlich viel ausspuckt, ohne dass wir auch nur einmal aufstehen müssten. Früher hatte man ein Album, ein Cover, ein Booklet, man kannte jeden Titel, wusste, an welcher Stelle die Gitarre einsetzt, wo der Sänger im dritten Refrain die Stimme anhebt. Heute drücken wir auf „Play“, und der Algorithmus erledigt den Rest, es gibt keine Pause mehr, kein „Ich lege bewusst etwas auf“, nur noch ein Strom. Musik ist von einem Erlebnis zu einem Hintergrundgeräusch geworden, das nebenbei laufen soll, ohne zu stören.
In dieser Welt zählt ein Song nicht, weil er gut ist, sondern weil er die ersten Sekunden übersteht. Die Plattformen messen nicht, ob uns ein Lied berührt, sondern ob wir weiterhören. Springt jemand nach acht, zehn Sekunden weiter, wird das Lied aussortiert, das Ergebnis sieht man überall. Intros verschwinden, Spannungsbögen verschwinden, lange Instrumentalteile verschwinden, alles muss sofort zur Sache kommen, sofort „hooken“, sofort funktionieren. Die Musikindustrie hat sich diesem System nicht nur angepasst, sie hat sich ihm unterworfen, es werden nicht mehr Künstler aufgebaut, sondern Songs gezüchtet. Ein Titel wird gepusht, überall platziert, in Playlists geschoben, als Sound bei TikTok platziert. Zündet er, wird er ausgeschlachtet, zündet er nicht, fliegt er raus und Interpret gleich mit.
Wer sich an die alten Zeiten erinnert, weiß, wie anders das war. Natürlich gab es auch damals massenhaft Schrott, nur spricht heute niemand mehr darüber, weil ihn niemand aufgehoben hat. In unserer Erinnerung sind vor allem die Überlebenden geblieben, die großen Songs, die starken Alben, die Stimmen, die eine Epoche tragen konnten. Wir vergleichen also unbewusst immer das Destillat der Vergangenheit mit der kompletten Rohmasse der Gegenwart. Dass die Gegenwart dagegen alt aussieht, ist logisch, aber es wäre zu billig, alles als Nostalgie abzutun. Der Unterschied liegt nicht nur im Kopf, er liegt im System.
Früher musste ein Sänger singen können. Es gab Korrekturen, es gab Tricks, aber im Studio stand kein Algorithmus, der jeden Ton millimetergenau glattzieht. Wer im Studio ablieferte, musste live zumindest in die Nähe dessen kommen, was auf der Platte war, heute übernimmt Auto-Tune den Rest, schief gibt es nicht mehr, nur noch glatt. Jede Unsicherheit kann herausgeschnitten, jede Note verschoben werden, das Ergebnis sind Stimmen, die makellos klingen, aber nichts mehr wagen. Kein Zittern, kein Riss, kein Moment, in dem man merkt, dass da gerade jemand auf eine Note zusprintet, von der er selbst nicht sicher war, ob er sie trifft. Die Musik klingt sauberer, aber sie klingt auch toter.
Das merkt man brutal bei Live-Auftritten. Es gibt sie noch, die Bands, die wirklich alles live spielen, aber gleichzeitig sind riesige Shows entstanden, in denen das Publikum im Grunde einer perfekt durchgeplanten Choreografie zusieht. Im Hintergrund laufen Clicktracks, vorproduzierte Chöre, Synthflächen und ganze Gesangsspur-Segmente. Der Sänger brüllt das Publikum an, rennt die Rampe runter, hält das Mikro hoch, doch im Zweifel trägt ihn die Backing-Spur. Man ist dabei und ist doch nicht dabei. Wer einmal erlebt hat, wie sich ein Sänger oder eine Band live kompliziert aus einer vertrackten Stelle herauskämpft, weiß, was da verloren geht. Das Risiko wurde aus der Popmusik entfernt, mit ihm ist ein gutes Stück „Wow“ verschwunden.
Parallel dazu hat sich auch unser Verhalten als Hörer verändert, viele von uns lassen Musik heute einfach „laufen“. Im Fitnessstudio, im Auto, bei der Arbeit. Wir hören nicht mehr bewusst, wir konsumieren. Der Algorithmus kennt unsere Gewohnheiten, unsere Tempo-Vorlieben, unsere Stimmungskorridore. Er gibt uns genau das, was uns nicht wehtut, nichts was irritiert, nichts was herausfordert, Musik als Wellnessprodukt. Genau hier beginnt der Punkt, an dem viele, die mit den Siebzigern, Achtzigern oder Neunzigern sozialisiert wurden, aussteigen, weil sie sich erinnern, wie anders sich Musik anfühlen kann, wenn sie nicht nur füllt, sondern trifft.
Trotzdem gibt es da noch etwas anderes, das man nicht ignorieren darf, die guten Sachen sind nicht weg, sie sind nur nicht mehr das, was einem ganz automatisch aufgedrängt wird. Es gibt junge Sängerinnen und Sänger, die live alles wegblasen, Bands, die sich die Finger wundproben, Studio-Nerds, die Alben bauen, die als Ganzes funktionieren. Aber sie laufen eher in Nischen, auf kleinen Bühnen, in speziellen Playlists, auf Plattformen, die nicht im Mainstream-Radar sind. Wer heute richtige Qualität will, muss sie sich erarbeiten, nicht mehr blind vertrauen, was die großen Labels durch die Maschine jagen, nicht mehr glauben, dass „Top Hits“ automatisch „beste Musik“ bedeutet.
Die Industrie selbst trägt ihren Teil dazu bei, dass es anders wirkt, ihr Geschäftsmodell ist kurzatmig geworden. Früher waren Plattenfirmen nicht aus Liebe zum Künstler da, aber sie hatten ein Interesse daran, bestimmte Namen als Marke über Jahre aufzubauen. Heute geht es viel öfter um die schnelle Nummer. Eine Saison, ein Trend, eine Kollaboration mit der passenden Marke, ein paar virale Clips, raus damit, danach kann der nächste kommen. Wenn man diese Zyklen einmal durchschaut hat, wundert es nicht mehr, dass sich viele Hörer vorkommen, als würden sie ständig mit Einheitsbrei abgespeist, während ihnen gleichzeitig eingeredet wird, dies sei der Gipfel dessen, was Musik im Jahr 2025 leisten könne.
Wer in dieser Landschaft an den siebziger Soul, an die Achtziger-Produktionen, an die Neunziger-Rock- und Pop-Bands denkt, ist nicht automatisch „stecken geblieben“, er hat nur noch einen Maßstab im Kopf, den ihm niemand abnehmen kann. Damals war nicht alles besser, aber das, was heute in den Rückblicken überlebt hat war handverlesen, oft mutig, manchmal größenwahnsinnig, fast immer getragen von Menschen, die so sehr für ihre Musik brannten, dass sie bereit waren, sich damit auf die Schnauze zu legen. Dieses Risiko hört man und man merkt schmerzhaft wenn es fehlt.
Die Frage ist deshalb weniger, ob die Musikbranche sich „verändert“ hat, das ist offensichtlich, die Frage ist, wie wir als Hörer damit umgehen. Ob wir uns von Playlists steuern lassen, die uns als Service verkauft werden, obwohl sie nichts anderes sind als algorithmisch sortierte Konsumstrecken. Ob wir jede glattgebügelte Stimme schlucken, nur weil sie perfekt ausproduziert ist. Ob wir mitmachen, wenn aus einem Sänger eine Marke, aus einem Song ein tausendfach verwertbares Sound-Schnipsel, aus einem Album eine Marketingkampagne wird, oder ob wir uns bewusst entscheiden, da auszusteigen.
Man muss den Altbestand nicht verehren wie eine Religion, aber man darf sich ruhig fragen, warum man beim alten Kram immer noch Gänsehaut bekommt und beim aktuellen Zeug meistens nur die Lautstärke runterdreht. Vielleicht liegt es nicht daran, dass wir alt geworden sind, vielleicht liegt es daran, dass wir noch wissen, wie sich echte Hingabe anhört. Wer dieses Gefühl kennt, spürt sehr genau, wenn er mit Lärm abgespeist wird und wer einmal verstanden hat, wie sehr die heutige Kommerzlogik auf maximale Verwertbarkeit statt auf maximale Wirkung optimiert ist, muss sich nicht mehr einreden lassen, dass das alles schon in Ordnung so sei.
Vielleicht ist das die eigentliche Rebellion in einer Zeit, in der alles jederzeit verfügbar ist, Musik nicht mehr nebenbei laufen lassen, sondern wieder zuhören, sich bewusst für Künstler entscheiden, die live abliefern. Alben wieder am Stück hören, Konzerte besuchen, in denen wirklich gespielt wird und sich selbst zugestehen, dass das, was uns an der heutigen Radioware nervt, kein eingebildeter Spleen ist, sondern ein berechtigtes Unbehagen. Denn wer einmal erlebt hat, wie sich Musik anfühlt, wenn sie nicht aus dem Algorithmus kommt, sondern von Menschen, die etwas zu sagen haben, der wird sich nicht mehr damit zufriedengeben, dass der nächste austauschbare Hit durch die Boxen läuft, nur weil er „gut performt“.