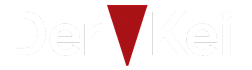Die Ächtung der Unbequemen – Wie Künstler und Autoren stigmatisiert, ausgeladen und an den Rand gedrückt werden
Die freie Gesellschaft lebt vom Widerspruch, sie braucht Künstler, die dorthin leuchten, wo das bequeme Einverständnis die Sicht verstellt. Doch genau diese Stimmen geraten immer häufiger ins Fadenkreuz. Es beginnt mit der Etikettierung als umstritten, setzt sich fort mit orchestrierter Empörung und endet nicht selten in Absagen, Ausladungen, Vertragskündigungen. Aus dem Anspruch auf Debatte wird ein Verfahren der Disziplinierung. Wer nicht spurt, verliert Bühne, Raum und Ruf. Es ist die leise, aber wirksame Zensur der Gegenwart, die selten so genannt wird und doch präzise so funktioniert.
Exemplarisch steht dafür der Fall Lisa Eckhart. Die österreichische Kabarettistin wurde 2020 zunächst vom Hamburger Harbour Front Literaturfestival ausgeladen, offiziell aus Sorge vor Störungen und Sicherheitsproblemen. Der Ablauf war bezeichnend. Zuerst die Empörung über Inhalte, dann der Rückzug des Veranstalters mit dem nachgereichten Hinweis auf Sicherheit, schließlich eine erneute Einladung, die Eckhart ablehnte. Übrig blieb das Signal, dass ein Shitstorm genügt, um eine Künstlerin vom Podium zu schieben. Dass der Nochtspeicher (traditionsreicher Musikclub in Hamburg-St. Pauli) später einräumte, es habe keine konkreten Drohungen gegeben, zeigt die Mechanik umso deutlicher. Die Wirkung ist die gleiche, die Botschaft an andere Künstler ebenfalls. Halte dich an den Kurs oder rechne mit dem Ausschluss.
Wer glaubt, dies sei ein Sonderfall, sollte auf den Umgang mit Uwe Steimle blicken. Der Mitteldeutsche Rundfunk beendete 2019 die Zusammenarbeit und strich seine Sendung, begründet wurde das mit einer zerrütteten Vertrauensbasis. In der Öffentlichkeit blieb vor allem das Etikett zurück, der Schritt markierte einen Punkt, an dem aus künstlerischer Provokation ein Fall für die Personalabteilung wurde. Natürlich steht einem Sender eine Entscheidung frei. Doch die politische Aufladung der Debatte, die reflexhafte Rahmung als nicht tragbar und das rasche Ende eines Formats zeigen, wie eng der Korridor geworden ist. Wer den Ton der Zeit nicht teilt, steht auf Abruf.
Auch die Popkultur blieb nicht verschont. Nena erlebte 2021, wie schnell Meinungsäußerung zu Absagen führt. Nach Kritik an Coronaauflagen wurde ein laufendes Konzert abgebrochen, weitere Auftritte wurden gestrichen. Es geht hier nicht um medizinische Richtigkeit oder politische Präferenzen, es geht um den schmalen Grat zwischen Hausrecht und öffentlicher Ächtung. Wenn bereits spontane Sätze von der Bühne reichen, um Karrieren zu beschädigen, ist die Schwelle zur Disziplinierung überschritten. Die freie Gesellschaft verträgt Widerspruch, sie muss ihn sogar aushalten. Wer ihn mit organisatorischen Mitteln aus dem Weg räumt, erzieht zu Angst statt zu Mündigkeit.
Besonders aufschlussreich ist der Streit um Roger Waters. Die Stadt Frankfurt wollte sein Konzert 2023 absagen, begründet mit dem Vorwurf des Antisemitismus. Ein Gericht stoppte die Absage und stellte unmissverständlich klar, dass Kunstfreiheit nicht nach politischer Opportunität gewährt wird. Ein Konzert ist als Kunstwerk zu betrachten, seine Absage wäre ein Eingriff in die Freiheit der Kunst. Man muss Waters nicht mögen, man kann seine Inszenierungen problematisch finden. Entscheidend ist, dass in einem Rechtsstaat nicht der lauteste Ruf nach Verbot die Schranke setzt, sondern das Grundgesetz. Wo Gerichte die Freiheit verteidigen müssen, weil die Politik ihr misstraut, sieht man, wie weit der Impuls der Ächtung bereits reicht.
Die Mechanik hat längst den globalen Kunstbetrieb erfasst. Ai Weiwei, international gefeierter Dissident, sah 2023 eine Londoner Ausstellung nach einem einzigen, kontrovers diskutierten Post zum Nahostkrieg auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Vorwurf lautete nicht auf Gewalt oder direkte Aufrufe, sondern auf falsche Haltung. Eine Galerie, die jahrzehntelang vom Nimbus des Dissidenten profitierte, zog die Reißleine, sobald dessen Dissidenz nicht mehr zur eigenen Moralarchitektur passte. Das ist der Kern der Gegenwart, Haltung gilt nur, solange sie kompatibel ist. Der Rest wird ausgelagert, vertagt, verschoben. Die Öffentlichkeit bekommt ein sauberes Schaufenster, die Kunst verliert ihre Zähne
Auch im Betrieb der Hochkultur wird mit harten Bandagen gearbeitet. Die russische Sopranistin Anna Netrebko verlor nach Kriegsausbruch in der Ukraine zahlreiche Engagements und klagt in den USA gegen das New Yorker Metropolitan Opera House, juristisch mag man das als Vertragsstreit lesen. Politisch ist es das Lehrstück, wie schnell Herkunft und angenommene Gesinnung über Bühnenpräsenz entscheiden. Kunst wird dann nicht mehr nach Werk und Leistung beurteilt, sondern nach Passierschein. Das Ergebnis ist ein Klima der Anpassung, Risiken lohnen nicht, Ambivalenz wird zur Gefahr.
Selbst der Literaturbetrieb ist nicht immun. Die Trennung des S. Fischer Verlags von Monika Maron im Jahr 2020 nach vier Jahrzehnten Zusammenarbeit war mehr als ein betrieblicher Vorgang. Sie wurde zum Signal, dass politische Zuschreibungen heute über künstlerische Zugehörigkeit entscheiden. Man kann diese Trennung verteidigen und als verlegerische Freiheit beschreiben, man kann sie als Fall von Cancel Culture kritisieren, unabhängig vom Urteil bleibt der Effekt identisch. Wer nicht in die ideologische Topografie eines Hauses passt, wird nicht mehr gedruckt. Das mag rechtlich sauber sein und bleibt kulturell dennoch verheerend, weil es die literarische Vielfalt verarmt und den Raum der Zumutungen verengt, die gute Literatur historisch immer gewagt hat.
Natürlich gibt es Grenzen, wo Kunst zur Lüge wird, wo falsche Tatsachen als Wahrheit verkauft werden, darf eine Redaktion eingreifen. Der Fall Lisa Fitz, deren Auftritt mit nachweislich falschen Zahlen zu Impftoten vom SWR aus dem Netz genommen wurde, zeigt diese Grenze deutlich. Der Punkt ist jedoch ein anderer. Aus einer notwendigen Korrektur wird allzu oft ein kulturpolitisches Verfahren, das sich nicht am Werk abarbeitet, sondern an Gesinnungsformeln. Statt Debatte über Inhalte herrscht die Verwaltung von Haltungen. Das zerstört Vertrauen in jene Institutionen, die eigentlich Räume für reife Auseinandersetzung sein sollten.
Das wiederkehrende Muster ist unübersehbar, erst kommen Vorwürfe und moralische Etiketten. Dann folgen organisatorische Reaktionen, die mit Sicherheit, Verantwortung oder Solidarität begründet werden. Am Ende bleibt der Ausschluss und mit ihm ein Schweigen, das nicht aus Einsicht entsteht, sondern aus Furcht. Eine Demokratie, die nur noch gefällige Kunst duldet, erzieht keine mündigen Bürger, sie trainiert Konformität, Kunst aber ist das Feld des Risikos. Sie darf und muss wehtun, sie darf falsche Fährten legen, übertreiben, irritieren. Der Preis für diese Freiheit ist die Bereitschaft, Ambivalenz auszuhalten. Der Gewinn ist eine Öffentlichkeit, die Übung hat im Denken.
Wer die Unbequemen an den Rand drängt, verlernt das Denken und verwechselt Ruhe mit Ordnung. Die Antwort kann nicht das Verbot sein, die Antwort ist der Streit. Wenn ein Festival aus Angst auslädt, wenn ein Sender im Zweifel löscht, wenn Städte Konzerte untersagen wollen, dann sagt das weniger über die Künstler aus als über den Zustand derer, die sich für Hüter der Wahrheit halten. Wer Kunst nur noch als pädagogisches Werkzeug begreift, macht aus ihr ein Amt, Kunst braucht Luft, sonst erstickt sie. Die demokratische Öffentlichkeit braucht Künstler, die man nicht mag, sonst verkümmert sie.
Es geht nicht darum, jeden Satz zu verteidigen, es geht darum, den Raum zu verteidigen, in dem Sätze überhaupt riskiert werden dürfen. Wer diesen Raum verengt, weil er den Aufwand einer schwierigen Debatte scheut, arbeitet nicht an einer besseren Gesellschaft, sondern an einer stilleren. Stille ist kein Fortschritt, Stille ist der Tod jeder lebendigen Kultur. Die freie Gesellschaft erkennt man an der Lautstärke ihrer Zumutungen. Sie erkennt man an der Großzügigkeit, mit der sie den Abweichler aushält. Sie erkennt man daran, dass sie den Spiegel nicht zerschlägt, nur weil das Bild nicht gefällt.