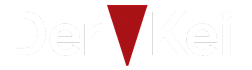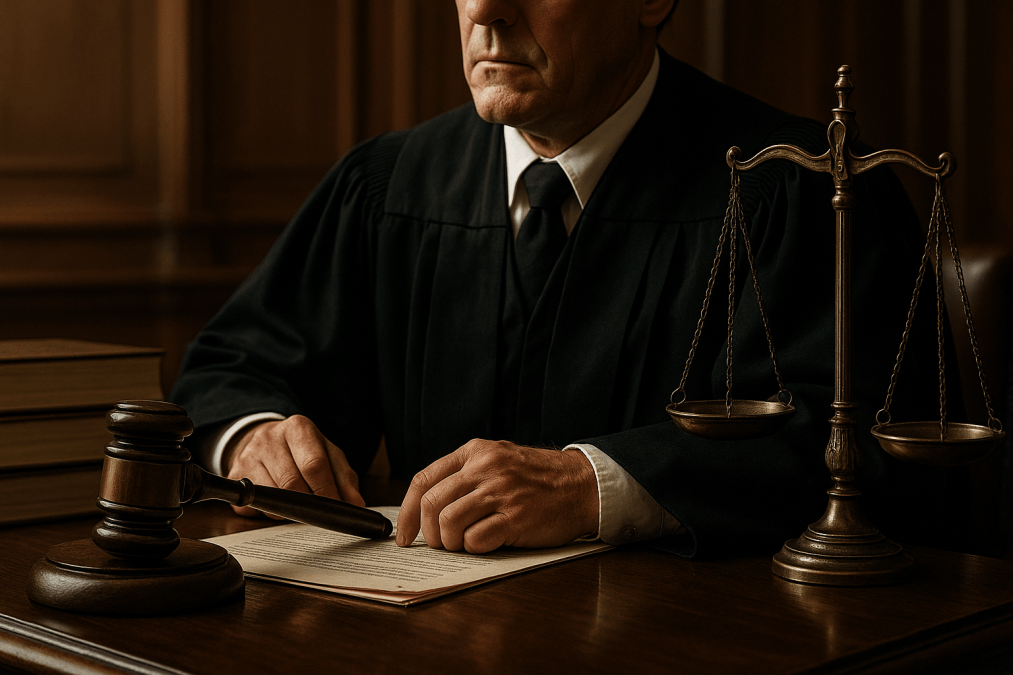
Der Mythos der „gerechten Justiz“
Die westliche Öffentlichkeit hält an einem bequemen Glaubenssatz fest, Gerichte seien neutral, Richter unbestechlich, das Verfahren an sich schon Gerechtigkeit. Dieser Glaube ist tröstlich, denn er entlastet. Wer verliert, habe eben „vor Gericht verloren“, nicht vor einem System, das Macht und Geld systematisch bevorteilt. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Wer genauer hinsieht, erkennt ein Geflecht aus politischer Einflussnahme, struktureller Schieflage und einer Kultur des Wegsehens, das sich in vielen Rechtsordnungen ähnlich zeigt, in den großen Skandalen ebenso wie im unspektakulären Alltag der Verfahren. Der Mythos hält nur, solange man nicht nach den Bedingungen fragt, unter denen Urteile überhaupt zustande kommen. Er platzt, sobald man die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit offenlegt und die Heuchelei benennt, die diesen Anspruch schützt.
Die britische Post-Office-Affäre zertrümmert die bequeme Erzählung in einem einzigen Schlag. Über Jahre hinweg wurden Hunderte Unschuldige verurteilt, weil ein Computersystem Fehler produzierte und die Institutionen bereitwillig so taten, als seien es Beweise. Es brauchte nicht etwa die Gerichte, sondern schließlich das Parlament, um die Urteile pauschal aufzuheben, ein Akt, der die Justiz zugleich rettete und bloßstellte. Wenn ein Gesetz Jahrzehnte von Fehlurteilen auf einen Streich löscht, entlarvt das eine Illusion, die tiefer reicht als das Versagen einer Behörde. Es zeigt, wie groß die Bereitschaft war, der Technik zu glauben, dem Apparat zu dienen und Menschen zu opfern, statt Zweifel zu kultivieren und Wahrheit zu erzwingen. Die Post-Office-Affäre ist nicht Randnotiz, sie ist Lehrstück, Gerechtigkeit ist nichts, was man institutionell besitzen kann. Sie ist etwas, das man gegen die Trägheit des Systems erarbeiten muss und häufig unterliegt.
Auch dort, wo Gerichte angeblich am weitesten von der Politik entfernt sind, wirkt die Politik durch das Tor der Personalie. In Deutschland wählen Bundestag und Bundesrat die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts mit Zweidrittelmehrheiten. Das Institutionsdesign soll die Unabhängigkeit sichern, doch es institutionalisiert zugleich die parteipolitische Hand im Auswahlprozess. Dass es Konsens und Kompromiss braucht, ist zivilisiert. Aber es ist auch ein Machtfilter, der bestimmt, wer überhaupt an den Tisch darf, mit welcher Biografie, welchem Stallgeruch, welchem ungeschriebenen Erwartungshorizont. Man kann das für bewährt halten, man muss aber anerkennen, dass die Behauptung absoluter Neutralität unter solchen Bedingungen eine höfliche Fiktion bleibt. Die Justiz schützt das Recht, doch die Politik entscheidet, wer diese Schutzfunktion ausübt.
Polen liefert das Gegenstück, die offene Eskalation, als die Regierung die Disziplinargewalt über Richter politisch band, reagierten die europäischen Gerichte ungewöhnlich klar. Der Europäische Gerichtshof erklärte das Disziplinarsystem für unvereinbar mit dem Unionsrecht, die EU verhängte Millionenstrafen, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte fest, dass zentrale Spruchkörper nicht mehr als unabhängige, gesetzlich errichtete Gerichte gelten. Der Streit ist juristisch komplex, politisch aber einfach zu deuten. Wo die Exekutive die Justiz disziplinieren kann, wird das Recht zum Werkzeug der Macht. Wenn ein Staat dann noch jahrelang versucht, dieses Modell zu halten, zeigt das, wie schnell der Mythos der neutralen Justiz ins Gegenteil kippt, sobald er mit realen Interessen kollidiert.
Ungarn wählte einen anderen Weg, unter dem Druck eingefrorener EU-Milliarden wurden 2023 und danach Reformen beschlossen, die die Justiz unabhängiger machen sollten. Geld floss wieder an, die Fassade glänzte neu, und doch blieben Zweifel, ob es sich nicht um Flickwerk handelt, das die strukturelle Abhängigkeit nur kaschiert. Wenn Rechtsstaatlichkeit vom Geldhahn abhängt, ist sie bereits beschädigt, der Preis für die Illusion ist hoch. Man zahlt ihn in Vertrauen, das nicht zurückkehrt, und in einem Rechtsempfinden, das stumpf wird, wenn Rechtsstaat zur Verhandlungsmasse gerät.
Wo Politik nicht direkt eingreift, erledigt das System den Selektionsdruck oft selbst. In den USA zeigt der Streit um „Judge Shopping“ die chirurgische Messerspitze, mit der Macht die Regeln der Verteilung ausnutzt. Kläger suchen die eine Gerichtskammer mit dem einen Richter, der die gewünschte Entscheidung wahrscheinlicher macht. Die Justiz reagierte 2024 mit einer Leitlinie, die mehr Zufall erzwingt. Aber schon die Existenz dieser Korrektur zeigt, wie real die Gefahr der politisch motivierten Richterwahl im Schatten des Systems ist und manche Gerichte verweigerten die Umsetzung, der Zufall bleibt also regional optional. Wenn die Verfahrensarchitektur erlaubt, aus dem Zufall eine Strategie zu machen, ist Neutralität nicht beschädigt, sie ist bereits kalkulierbar geworden.
Geld verschiebt die Gewichte nicht nur in der Auswahl der Richter, sondern mitten im Verfahren. Wer mit Kaution aus der Untersuchungshaft bleibt, kann sich verteidigen, arbeiten, Beweise sammeln. Wer bleibt, verliert Job, Wohnung, Kinder und den Kopf. Studien zeigen, dass die Entscheidung für Bargeldkaution die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung messbar erhöht, unabhängig von Schuld. Hier triumphiert nicht Recht, sondern Lebensrealität. Armut wird zu einem verfahrensrechtlichen Risikofaktor, Reichtum zur stillen Versicherungspolice. Eine Ordnung, die das als „normal“ hinnimmt, belohnt nicht Unschuld, sondern Zahlungsfähigkeit.
Dasselbe Muster wiederholt sich in den großen Wirtschaftsstrafverfahren. Konzerne kaufen sich mit Deferred-Prosecution-Agreements aus dem Strafprozess frei, zahlen Milliarden, geloben Besserung, behalten aber die Personalschäden und die öffentliche Demütigung vom Leib. Der Fall HSBC ist Protokoll dieser Praxis. Nach erwiesenen Verstößen akzeptierte das Justizministerium eine Verschiebung der Strafverfolgung gegen Auflagen. Später zeigten Recherchen und interne Unterlagen, wie sehr die Sorge um das Finanzsystem echte Anklagen ausbremste. Auch das ist Justiz, aber sie hat einen anderen Namen, sie heißt Risikomanagement. Für Bürger gibt es Urteile, für Konzerne Konditionen. Man kann das pragmatisch nennen, man sollte es beim Namen nennen. Es ist eine ökonomische Hierarchie, die bis in die Gerichtssäle hinaufreicht.
Die Technik versprach die Rettung vor menschlicher Willkür, Algorithmen sollten voraussagen, wer wieder straffällig wird, nüchtern, datenbasiert, kalt. In der Praxis reproduzierten sie alte Vorurteile mit mathematischer Präzision. Untersuchungen zeigten höhere Fehlalarmraten gegen Schwarze und vermeintliche Neutralität, die sich als statistischer Taschenspielertrick entpuppte, weil unterschiedliche Fairnessbegriffe gegeneinander ausgespielt wurden. Der Algorithmus befreit nicht von der Verantwortung, er verbirgt sie nur hinter Formeln, an der Front des Gerichts ändert das nichts. Die Entscheidung bleibt politisch, sozial, moralisch aufgeladen, nur dass jetzt der Computer den Anschein der Objektivität liefert.
Wer behauptet, Korruption sei die Randzone des Systems, sollte nach Italien schauen, wo Affären um Einflussnahmen auf Spitzenposten der Justiz die Selbstverwaltung erschütterten und der Europarat zuletzt nochmals mahnte, die Integrität der Institutionen zu stärken. Man muss nicht jedes Detail zu Ende erzählen, um das Muster zu erkennen. Wo Netzwerke darüber entscheiden, wer aufsteigt, entscheidet nicht Unabhängigkeit, sondern Zugehörigkeit. Das ist die subtile Form der Korruption, die schwer zu justiziieren und leicht zu normalisieren ist.
Die globale Vermessung des Rechtsstaats liefert den Hintergrund zu all dem. Der Rule-of-Law-Index und Korruptionsrankings zeichnen seit Jahren ein Bild schleichender Erosion. Nicht überall und nicht immer, aber breit genug, um den Mythos zu beschädigen. Der Trend ist kein Naturgesetz, er ist menschengemacht, Ergebnis politischer Entscheidungen und institutioneller Kompromisse, die Unabhängigkeit proklamieren und Abhängigkeiten organisieren. Wer das leugnet, verteidigt nicht die Justiz, sondern den Trost, den sie verspricht.
Gerechtigkeit beginnt nicht im Gesetzbuch und endet nicht im Urteil, sie beginnt in der Frage, wer Macht hat, Verfahren zu gestalten, und endet in der Antwort, wer die Folgen tragen muss. Heute trägt die Last, wer arm ist, wer ohne Netzwerk kommt, wer in Systeme gerät, die ihre eigenen Fehler nicht erkennen wollen. Die Justiz ist kein Feind, aber sie ist auch nicht die Heilige. Sie ist eine Arena, in der Interessen ringen, in der Politik an den Rändern drückt, in der Reichtum Puffer schafft, die anderen fehlen, und in der Technik die alten Vorurteile nur effizienter macht. Wer Gerechtigkeit will, muss den Mythos zerstören, die Rituale entzaubern, die Abhängigkeiten benennen und die Verfahren umbauen, damit das Recht nicht länger ein Theater der Selbstbestätigung bleibt. Neutralität ist kein Zustand, sie ist eine Aufgabe und solange das nicht Leitlinie, sondern Legende bleibt, wird das Urteil zu oft nur der elegante Schlusspunkt einer Niederlage sein, die weit vor dem ersten Verhandlungstag begonnen hat.