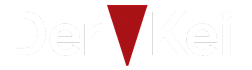Fahnenflucht im Schatten des Krieges – Warum Soldaten in Russland und der Ukraine den Dienst verweigern
Seit mehr als drei Jahren dauert der Krieg in der Ukraine nun an. Millionen von Menschen sind in unterschiedlicher Form in diesen Konflikt hineingezogen worden, Hunderttausende direkt an der Front. Während die offizielle Rhetorik beider Staaten den „Heldentod für die Heimat“ beschwört, zeigen nüchterne Zahlen und Berichte ein anderes Bild. Sowohl in Russland als auch in der Ukraine hat sich Fahnenflucht zu einem Phänomen entwickelt, das längst nicht mehr nur Einzelfälle betrifft, sondern ganze Strukturen belastet.
In der Ukraine meldeten die Justizbehörden bis Ende 2024 mehr als 100.000 Verfahren wegen Desertion oder unerlaubten Entfernens von der Einheit. Allein im Jahr 2023 waren es fast 30.000 neue Fälle. Zwar ist nicht jeder dieser Fälle ein endgültiges Absetzen aus der Armee, doch die Tendenz zeigt, dass viele Soldaten die psychische und physische Belastung des Krieges nicht mehr ertragen können. Auch der ukrainische Militärgeheimdienst räumt ein, dass in manchen Brigaden die Ausfälle durch Desertion so groß sind, dass die Einsatzfähigkeit beeinträchtigt wird.
In Russland ist das Bild weniger klar, da Zahlen weit stärker unter Verschluss gehalten werden. Doch Recherchen unabhängiger Medien wie iStories oder Mediazona zeigen, dass auch hier zehntausende Verfahren gegen Deserteure laufen. In manchen Regimentern, so berichten Aussteiger, sei ein signifikanter Teil der Truppe entweder geflohen oder tauche regelmäßig ab. Die russische Armee reagiert mit drakonischen Strafen, die von jahrelangen Haftstrafen bis hin zu Sonderkommandos in Strafbataillonen reichen. Trotz dieser Härte nimmt die Zahl der Fälle nicht ab.
Die Gründe für Fahnenflucht sind komplex und lassen sich nicht auf eine einzige Motivation reduzieren. Manche Soldaten handeln im vollen Bewusstsein der Konsequenzen, weil sie den Tod an der Front nicht mehr riskieren wollen. Für sie ist der Weg in ein Straflager oder die Flucht ins Ausland weniger furchteinflößend als das sichere Sterben in einem Schützengraben. Andere verschwinden aus reiner Verzweiflung, ohne Plan und ohne Rücksicht auf die Folgen. Sie wählen den unmittelbaren Reflex der Selbsterhaltung, oft ausgelöst durch extreme Kampferfahrungen, Verlust von Kameraden oder den Druck permanenter Gefechte.
Ein weiterer zentraler Faktor ist die Familie. Viele ukrainische und russische Soldaten sind Väter und Ehemänner. Wenn sie erkennen, dass ihr Tod nichts anderes als eine Statistik in den Kriegsberichten wäre, entscheiden sie sich, das Risiko einer Desertion auf sich zu nehmen, um für ihre Angehörigen am Leben zu bleiben. Gerade in Russland, wo Mütter und Ehefrauen zunehmend öffentlich gegen die Verlängerung von Fronteinsätzen protestieren, spiegelt sich dieser familiäre Druck deutlich wider.
Die gesellschaftliche Stigmatisierung spielt eine zwiespältige Rolle. Offiziell gelten Deserteure in beiden Staaten als Verräter, in der Realität aber wächst das Verständnis, zumindest im privaten Umfeld. Viele Zivilisten wissen um die Hölle an der Front und verurteilen nicht, wenn einer sich dem entzieht. Die Diskrepanz zwischen offizieller Heldenverehrung und privater Resignation lässt die Kluft zwischen Propaganda und Lebensrealität immer größer werden.
Die Frage, ob Desertion ein bewusster Akt gegen das System oder ein blinder Reflex aus Angst ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten, beides kommt vor. Manche Soldaten bereiten ihren Ausstieg über Monate vor, organisieren Fluchtwege und Kontakte, manche kehren nach Heimaturlaub einfach nicht zurück. Andere laufen buchstäblich in der Nacht aus dem Schützengraben davon, getrieben von der nackten Furcht vor dem nächsten Artillerieschlag.
So zeigt sich, Desertion ist weder reines Kalkül noch bloße Panik. Sie ist Ausdruck einer tiefen inneren Zerrissenheit, die in jedem Krieg entsteht, wenn Individuen zwischen dem Zwang zur Loyalität und dem Wunsch zu überleben gefangen sind. Die Zahlen aus beiden Armeen machen deutlich, dass dieser Konflikt für viele längst nicht mehr ein Kampf um Patriotismus oder Ehre ist, sondern ein existenzieller Kampf ums eigene Leben, auch gegen die eigenen Vorgesetzten.